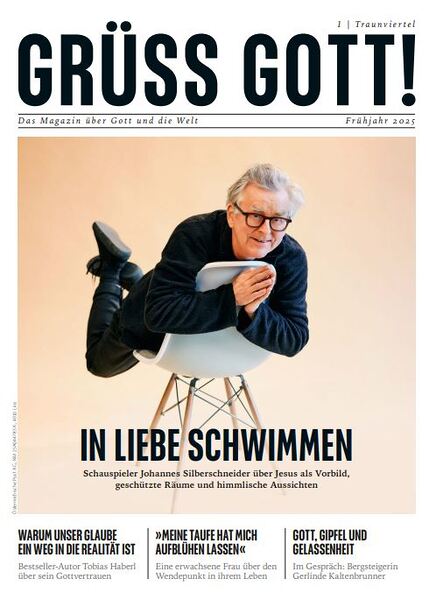Begräbnis von Nikolaus Harnoncourt in St. Georgen im Attergau

Die Diözesanbischöfe Wilhelm Krautwaschl und Franz Lackner würdigten am Wochenende die großen Verdienste des verstorbenen weltbekannten Musikers und sprachen der Familie ihre Anteilnahme aus. "Wir werden seiner im Gebet gedenken."
Harnoncourt war am Samstag, 5. März 2016 im Alter von 86 Jahren in St. Georgen im Attergau gestorben, wo er mit seiner Frau Alice im ehemaligen Pfarrhof wohnte. Der gebürtige Berliner kam aus einem katholischen Elternhaus und wuchs in Graz auf. Sein Bruder, Philipp Harnoncourt, ist Priester und Theologe. Der Cellist war einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis für Alte Musik. Als Gastdirigent zahlreicher Spitzenensembles zählte Harnoncourt zu den weltweit angesehensten Orchesterleitern. So dirigierte er wiederholt das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.
Der steirische Diözesanbischof Krautwaschl zeigte sich "tief getroffen" von der Nachricht vom Tod Harnoncourts. Dieser große Sohn der Steiermark habe "mit seinem Werk nicht nur künstlerisch das Publikum berührt, sondern durch seine Liebe zur sakralen Musik die spirituelle Dimension und den Himmel den Menschen erschlossen".
"Er war einer der ganz Großen", betonte der Salzburger Erzbischof Lackner. "In seiner Arbeit ist er nie dem Zeitgeist gefolgt. Mit seinen bahnbrechenden Interpretationen hat er Neues entdecken lassen", so Lackner laut einer Aussendung der Erzdiözese Salzburg. Harnoncourt habe den Zeitgeist geprägt, betonte der Erzbischof - "gegen viele Widerstände, denn es ist ihm um die Sache, um die Musik gegangen".
Lackner würdigte den verstorbenen Musiker als "Suchenden nach dem Schlüssel, wie dem Zuhörer die Musik zu erschließen sei". Mit dem Tod Harnoncourts verliere man vor allem aber auch einen wertvollen Menschen, wie der Erzbischof betonte: "In Büchern, Interviews hat er uns teilhaben lassen an seinen Gedanken. In seinem letzten Brief an das Publikum schreibt er: 'Da wird wohl Vieles bleiben!' Sein Blick ging immer in die Tiefe, gleichsam suchend, ja ringend, um die Geheimnisse des Lebens und - wie ich sein Schaffen verstehen möchte - des Glaubens zu entdecken. Unvergesslich wird mir die Begegnung mit Nikolaus Harnoncourt im Vorjahr anlässlich einer Auszeichnung, die ihm zu teil wurde, bleiben. Ich war tief berührt, als er mir, dem musikalisch Untalentierten, in einem Gespräch Musik erklärt hat. Der Tod dieses Mannes lässt nicht nur mich traurig zurück."
Begräbnis am Samstag in St. Georgen im Attergau
Das Begräbnis von Nikolaus Harnoncourt findet am kommenden Samstag, 12. März 2016 in kleinem Rahmen in St. Georgen im Attergau statt. Der Ehrenbürger der oberösterreichischen Gemeinde hatte sich seit den 1970er Jahren immer wieder dorthin zurückgezogen und den Ort als Inspirationsquelle für musikalische Ideen genützt. Auf Wunsch des Dirigenten soll die Abschiedsfeier betont schlicht gestaltet sein. Neben der Familie des Musikers und Dirigenten sind nur die Pfarrbevölkerung und ein paar wenige Ehrengäste eingeladen - darunter Landeshauptmann Josef Pühringer und Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel.
Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Donnerstag berichten, betrachtete Harnoncourt St. Georgen als zweites Zuhause. 1973 bezog der bekennende Katholik mit seiner Familie den alten Pfarrhof im Ort Lohen, der zur Gemeinde gehört. "Harnoncourt hat sich irrsinnig wohl gefühlt im Attergau", berichtet Alt-Bürgermeister Wilhelm Auzinger. Als bekennender Katholik habe der Musiker regelmäßig die Sonntagsmesse in der Pfarrkirche besucht. "Ich habe mit ihm nach der Messe immer ein paar Worte gewechselt", erinnert sich Auzinger.
Harnoncourt wirkte im Attergau aber auch musikalisch, wie die OÖN erinnerten: Zum 300. Todestag des Barockmusikers Johann Beer im Jahr 2000 führte er mit seinem Concentus Musicus die Beer-Messe Missa Sancti Marcellini in der Pfarrkirche St. Georgen auf. Mit dem Kirchenchor studierte er zudem die Paukenmesse von Joseph Haydn (1991) und die Waisenhausmesse von Wolfgang Amadeus Mozart (1994) ein.
Im Gedenken an den am 5. März im 87. Lebensjahr verstorbenen großen österreichischen Komponisten Nikolaus Harnoncourt finden kommende Woche in Graz und Wien Seelenmessen statt. Jene im Grazer Dom am Freitag, 18. März um 14 Uhr wird ebenso der jüngere Bruder des Verstorbenen, der Grazer Liturgiewissenschaftler Philipp Harnoncourt, leiten wie das tags darauf folgende Requiem in der Wiener Piaristenkirche Maria Treu (Samstag, 19. März, um 11.30 Uhr).
Welche kirchlichen Vertreter sonst an den beiden Trauerfeiern teilnehmen werden, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Tod Harnoncourts hatte auch in Kirchenkreisen große Bestürzung ausgelöst; Würdigungen für den großen Musiker formulierten u. a. der Salzburger Erzbischof Franz Lackner und sein Grazer Amtskollege Wilhelm Krautwaschl.
Kunst "die Nabelschnur" zum Göttlichen
"Wir Musiker", sagte Nikolaus Harnoncourt einmal, "haben eine machtvolle, ja heilige Sprache zu verwalten. Wir müssen alles tun, dass sie nicht verloren geht im Sog der materialistischen Entwicklung. (...) Die Kunst ist eben keine hübsche Zuwage, sie ist die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet".
Harnoncourt studierte Cello in Wien und wurde 1952 bei den dortigen Symphonikern aufgenommen. Kurz darauf gründete er mit seiner Frau und Orchesterkollegen den Concentus Musicus Wien. Das Ensemble verschrieb sich einer Aufführungspraxis, die auf Originalinstrumenten dem ursprünglichen Klang von Renaissance- und Barockmusik so nahe wie möglich kommen wollte.
Mit diesem Ansatz gelangen Harnoncourt herausragende Interpretationen bei Plattenaufnahmen und Konzerten auf der ganzen Welt. Einen Zentralpunkt bildet dabei das komplette Kantatenwerk Bachs, das gemeinsam mit Gustav Leonhardt im Rahmen eines fast 20 Jahre dauernden Projektes aufgenommen wurde.
1972 begann Harnoncourt, auch zu dirigieren. 1975 startete die langjährige Zusammenarbeit mit dem Concertgebouw Orchester in Amsterdam. 1983 debütierte er am Dirigentenpult der Wiener Symphoniker, 1984 bei den Wiener Philharmonikern, 1987 an der Wiener Staatsoper und 1992 bei den Salzburger Festspielen.
Als Autor vielbeachteter Bücher und als Pädagoge versuchte Harnoncourt, seine Einsichten über das Dialogische der Musik zu vermitteln. 20 Jahre lang unterrichtete er als Professor für Aufführungspraxis an der Musikuniversität Mozarteum in Salzburg
Gegen heftigen Widerstand des etablierten Musikbetriebs sorgte Harnoncourt, der selbst historische Instrumente sammelte, für eine Blüte des werkgetreuen Musizierens. Zu seinen Favoriten zählen Mozart und Haydn. Seit 1985 gibt es in Graz die "Styriarte", Harnoncourt gewidmete Klassik-Festspiele, die rasch großes Ansehen gewannen.