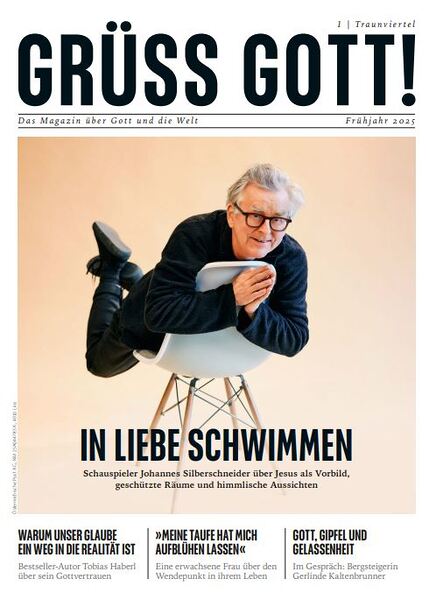Weltsynode: Kirchen-Reform mit mehreren Geschwindigkeiten
Im Oktober 2024 wollen die Delegierten sich erneut in Rom versammeln. Es geht um mehr "Synodalität" - einen Leitungsstil, der auf breitere Beteiligung und Vielfalt setzt. Schon jetzt zeigt sich, dass Katholiken global mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind.
Das liegt auch am kulturellen Umfeld und an den Mehrheitsverhältnissen. Die Synode erkennt im Schlussbericht die "Pluralität der Ausdrucksformen von Kirche-Sein" an; diese hat ihre Rechtfertigung in den verschiedenen Kulturen, in denen Katholiken leben. Aber nicht überall gelten Änderungen als erstrebenswert, wie sie liberale westliche Gläubige sich erhoffen.
Beispiel Südostasien: In Gesellschaften, in denen Tradition sehr wichtig ist, würde ein Abrücken vom priesterlichen Zölibat eher Geringschätzung hervorrufen, meint ein hoher Kurienmitarbeiter aus der Region. Ähnlich stieße ein anderer Umgang mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen auf Schwierigkeiten - zumal in islamisch oder hinduistisch geprägten Ländern. In Indonesien, dem Land mit den meisten Muslimen weltweit, ist Homosexualität nicht gut gelitten: "'Es gibt sie, aber man redet nicht darüber", so der Vatikan-Geistliche.
Hinzu kommt die Minderheitensituation der Christen. Für Asien gibt der Vatikan einen Katholikenanteil von 3,3 Prozent an; außer auf den Philippinen, in Osttimor und Südkorea bilden sie kleine Herden - und überlegen sich genau, ob sie als revolutionär auffallen wollen. "Der Wind der Veränderung weht überall; es ist nicht ratsam, ihn auch noch zu verstärken", sagt der Kuriale. Der neue Umgangsstil, den die Synode anregt, wird nach seiner Einschätzung in Asien frühestens in zehn Jahren greifen.
Lateinamerika weit voraus
Wenn es um mehr Spielraum für Laien in der Seelsorge geht, ist Lateinamerika weit voraus. Nicht nur in der Amazonasregion haben Laien und Ordensfrauen längst Teile des Gemeindelebens, der Gottesdienste und der Glaubensunterweisung übernommen.
Schon die Amazonas-Synode 2019 wollte verheiratete Männer zu Priestern machen und eigene Dienstämter für Frauen schaffen, doch damals ging der Papst darauf nicht ein.
Afrika: Selbstbewusste Ordensfrauen
Ebenso tragen in Afrika viele Ordensfrauen schon jetzt viel Verantwortung. Manche Gläubige kennen nicht mehr "den Unterschied zwischen einem Priester und einer Schwester", meint etwas zugespitzt Schwester Maamalifar Poreku aus Ghana.
Laut Poreku, die sich für Klima-Erziehung und für Frauenrechte einsetzt, nehmen Ordensschwestern ihren Missionsauftrag längst mit eigenem Selbstbewusstsein wahr. "Ich würde es keinem Priester erlauben, mich herabzusetzen", sagt sie. "Papst Franziskus kämpft auf seine Weise gegen Klerikalismus, ich auf meine."
Das Schlussdokument der Synode geht im Übrigen nur in einem Punkt ausdrücklich auf Afrika ein: mit dem Vorschlag, einen flexibleren Umgang mit Polygamie zu prüfen. Und einen indirekten Bezug gibt es: Die Abkürzung LGTBQ+ für unterschiedliche Geschlechteridentitäten steht nicht im Text. Andernfalls wäre es wahrscheinlich gewesen, dass afrikanische Teilnehmer dagegen gestimmt hätten, heißt es aus dem Synodensekretariat. Dennoch stehe das im Text, was damit gemeint ist.
Einen anderen Sonderwunsch brachten Vertreter aus Nahost im Text unter - sie wollen einen eigenen Rat von Oberhäuptern katholischer Ostkirchen beim Papst installieren.
Kluft in Europa und den USA
Vor welchen Spannungen die Weltkirche steht, wird nicht zuletzt mit Blick auf die USA deutlich: "Keine Kirche ist so gespalten", sagt ein Synodenmitglied. Gegensätze zwischen englischsprachigen und von Hispanics geprägten Ortskirchen gehörten dazu. Und es gibt unversöhnliche Lager, wenn es um Themen wie Ämterverständnis, Sexualethik oder Sorge um Migranten geht; bei den Beratungen in Rom fielen die US-amerikanischen Teilnehmer durch eine relativ starke konservative Fraktion auf.
Ähnliches gilt für Europa. Zwischen dem deutschen "Synodalen Weg", traditionsfesten Diözesen Osteuropas oder Regionen wie Skandinavien gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung, wie sehr Reformen nötig sind. Das Synoden-Dokument hält fest, dass es "zwischen der Wahrung des Bandes der Kircheneinheit und der Gefahr der Homogenisierung" einen Ausgleich zu finden gilt. Ein knappes Jahr haben die Ortskirchen Zeit, sich darüber weitere Gedanken zu machen.

Die Versammlung der Bischofssynode beriet von 4. bis 29. Oktober 2023 über ein neues Miteinander in der katholischen Kirche. © Kathpress / Paul Wuthe
Schlusstext der Weltsynode auf Deutsch veröffentlicht
Ab sofort gibt es auch eine deutsche Fassung des Schlusstextes der ersten Phase der Weltsynode. Das 40 Seiten umfassende Dokument ist in 20 Kapitel gegliedert und enthält insgesamt 270 Unterpunkte. Diese wurden von den 346 Synodalen im Vatikan am Samstag nach vierwöchigen Debatten alle einzeln abgestimmt. Jeder der Punkte erhielt eine Mehrheit von mindestens 80 Prozent.
In dem Text werden unter anderem eine Weiterentwicklung der katholischen Sexualmoral, ein Überdenken des Zölibats und eine Änderung der Strukturen zur Entscheidungsfindung in der Kirchenhierarchie vorgeschlagen. Im Punkt über eine mögliche Öffnung des Diakonenamts für Frauen wird fehlende Einigkeit festgestellt. Über konkrete Empfehlungen an den Papst wird erst die zweite Runde der Weltsynode im Oktober 2024 beraten.
Das italienische Original umfasst 37 Druckseiten. Mittlerweile liegt das Dokument auf Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch und Polnisch vor.
Zulehner in Synoden-Zwischenbilanz: "Epochaler Sprung nach vorn"
Eine positive Zwischenbilanz nach der ersten von zwei Weltbischofsversammlungen zur Synodalisierung der katholischen Kirche hat der Wiener Theologe Paul M. Zulehner gezogen. Mit Blick auf den Bericht zum Abschluss der Vatikan-Synode von 4. bis 29. Oktober schrieb er in seinem Blog von einem "epochalen Sprung nach vorn". Dies zeige sich, in einer neuen Kommunikationskultur und in der Aussicht auf eine "innerkatholische Ökumene" mit mehr Befugnissen für kirchliche Kontinentalversammlungen und die Diözesen. "Manche bei uns mögen es belächeln: Aber es war ein Sprung nach vorn, dass in der Synodenaula viele Tische für Kleingruppen standen, an dem Frauen und Männer mit Bischöfen und Kardinälen saßen und auf Augenhöhe miteinander berieten", schrieb Zulehner.
Die Synodenarbeit lebte vom Hören auf den Heiligen Geist und vom Versuch, die Geister zu unterscheiden, erinnerte der Theologe an die Startvorgaben von Papst Franziskus. "Man lernte Zuhören, Respekt für die Meinungsvielfalt, konnte den Dissens aushalten." Die "Spiritualisierung" des Vatikan-Treffens verursachte laut Zulehner allerdings auch "eine Art unproduktiver Konfliktvermeidung": Schon lange anstehende Reformthemen seien folglich nicht vorangebracht worden.
Der Zwischenbericht äußere dazu die Hoffnung, "dass es im kommenden Jahr gerade in kontinentalen Versammlungen, aber auch in den Ortskirchen neue Impulse zu den offenen Fragen geben werde". Das wäre ein "Vorspiel für den wohl bahnbrechenden Erfolg" der Synodenversammlung im Oktober 2024, wenn die kirchlichen Ebenen unter der Zentrale in Rom mit neuen Befugnissen ausgestattet würden, so Zulehner. Sein Ausblick darauf: "Dann müssten die Kirchen in Afrika nicht mehr der Freistellung des Zölibats in Amazonien zustimmen und osteuropäische Kirchengebiete nicht der Segnung von homosexuellen Paaren."
Der "Reformstau" in der katholischen Kirche könnte sich durch eine solche Weichenstellung in Richtung Anerkennung innerkatholischer Vielfalt "endlich auflösen", lautete Zulehners Prognose.
Keine Abwertung von "Parlament" mehr
Die Oktober-Versammlung im Vatikan sei nicht eine der gewohnten Bischofssynoden gewesen, sondern eher eine "Volk-Gottes-Synode", in der nicht nur Bischöfe, sondern Frauen und Männer kraft ihrer Taufe, Sitz und Stimme hatten. Das könne jene Ortskirchen wie die Kirche in Deutschland ermutigen, die eine Art dauerhaftes "Kirchenparlament" wünschen und damit Synodalität institutionalisieren. Erfreulich ist nach den Worten des Theologen, dass der bisher nur auf Italienisch vorliegende Synoden-Bericht "die schroffe Gegenüberstellung von Synode und Parlament verlassen hat". Das mache Sinn, weil der Geist Gottes ja nicht nur in der Synode am Werk sei, "sondern eben auch in Parlamenten, die um das Gemeinwohl ringen".
Für manche Bischöfe sei die Versammlung "ein richtiges Zuhörtraining" gewesen, erinnerte Zulehner an die Aussage eines deutschen Bischofs. Und "es könnte sein, dass manche Bischöfe damit verändert in ihre ortskirchliche Amtsführung heimkehren". Auch das wäre ein schöner Erfolg, schrieb Zulehner.
Offene "heiße Eisen"
Die hohe Zustimmung der Synodalen zum vorliegenden Text sei "freilich dadurch erkauft" worden, "dass viele Fragen nicht gelöst, sondern als weiterhin offen benannt wurden". Das bedeute für das kommende Jahr viel Arbeit, wies der Theologe hin.
Offen geblieben seien etwa die Themen Frauendiakonat, Zölibatsverpflichtung, kirchliche Sexualkultur, Genderfrage sowie Segnung gleichgeschlechtlich liebender Paare. Das mag jene enttäuschen, die schon jetzt Entscheidungen erwartet haben. Aber - so Zulehners Einwand - es wird auch jene beunruhigen, die diese Fragen vom Synodentisch weghaben wollten. "Das sind laut Abstimmungszahlen bei sensiblen Fragen mit einem Drittel gar nicht so wenige."
Es hat sich nach Zulehners Einschätzung bei der Synode gerächt, dass anders als beim Zweiten Vatikanischen Konzil theologische Fachleute nicht an den Tischen der Synoden-Aula saßen. Dem nun vorliegenden Bericht sei dies auch klar. Nicht umsonst werde gerade für die "Vertiefung" der offen gebliebenen Fragen um die Arbeit der Theologen und anderen Wissenschaften gebeten.
Weltgeschehen blieb nicht außen vor
Eine Befürchtung Zulehners u.a. Fachleute habe sich bei der Synodalversamlung nicht bestätigt: dass es nämlich primär um innerkirchliche Reformen gehen werde. Der Bericht sei erfreulicherweise nicht dabei stehen geblieben: Die aktuell so "taumelnde Welt" sei präsent gewesen, "nicht zuletzt durch Personen, die aus den Krisenherden kamen, aus der Ukraine und Russland, aus Israel und Palästina". Auch dem Thema Migration und sogar der Informatisierung wurde nach der Beobachtung Zulehners hohe Aufmerksamkeit geschenkt, "der Schrei der Erde und der Armen wurde gehört".
Zulehners Schlusssatz mit Blick auf das Jahr bis zur abschließenden Weltsynode im Oktober 2024: "Es bleibt also spannend auf dem Synodalen Weg der Weltkirche."
Lesen Sie auch: Linzer Synodenberaterin Prof.in Klara A. Csiszar über Inhalte und Ergebnisse der Weltsynode
Kathpress-Themenschwerpunkt mit allen Meldungen zur Synode in Rom abrufbar unter www.kathpress.at/synodenversammlung2023